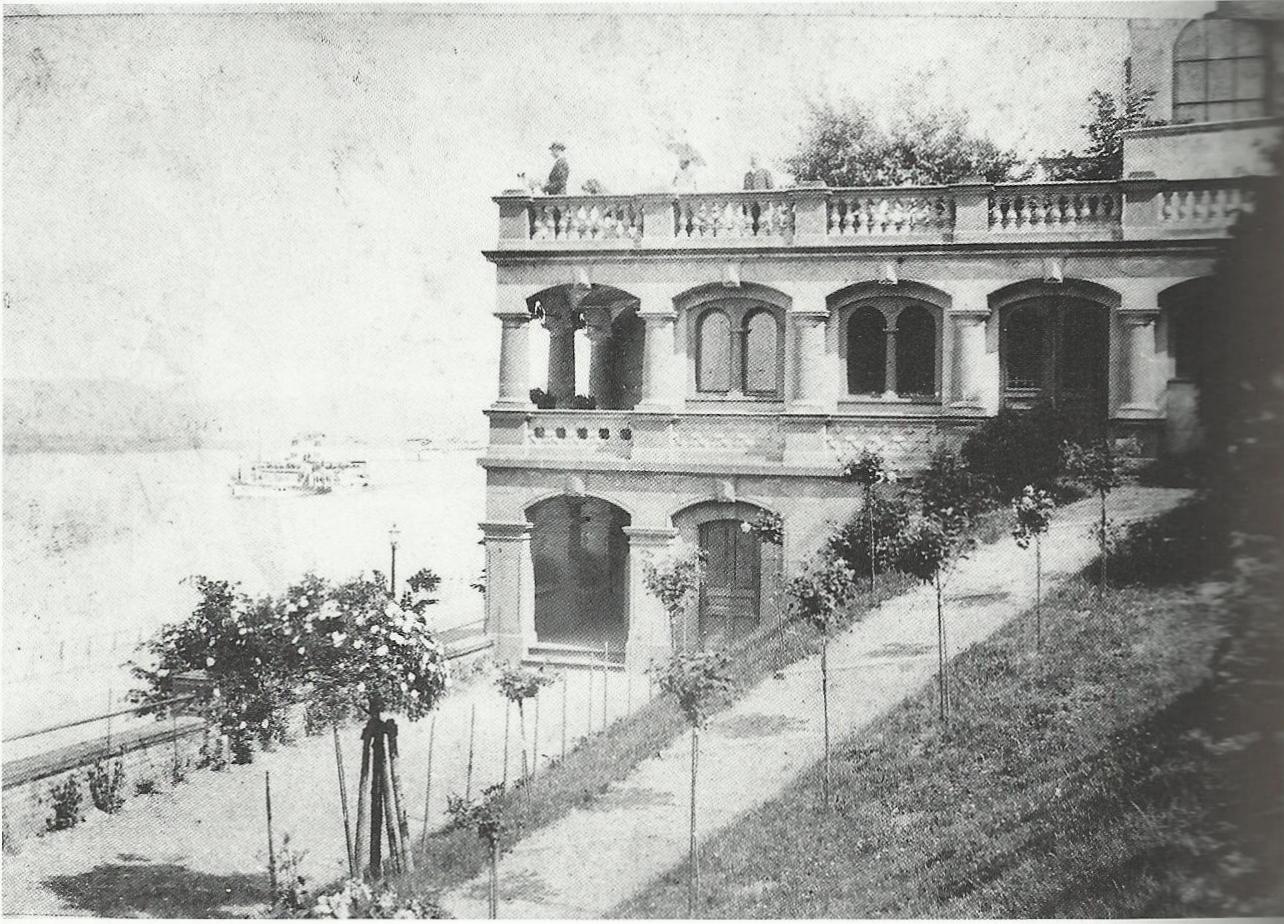Denken wir an Dienstmädchen, dann kommen uns vermutlich dieselben Bilder und Filme in den Sinn: Wir denken vielleicht an das Haus am Eaton Place oder an Dontown Abbey, wo die Dienstboten im Kellergeschoss ihr eigenes Reich hatten, das streng hierarchisch geordnet war.
Wir denken vielleicht an Filme, in denen hübsche Zofen ihre eitlen Herrinnen in enge Korsetts schnürten (und von Korsetts wollen wir jetzt nicht reden, das Faß mache ich ein anderes Mal auf …) oder in denen noch hübschere Stubenmädchen dem Hausherrn entweder schöne Augen machten oder sich von ihm Frechheiten gefallen lassen mussten.
Vielleicht erinnern wir uns auch an Schwarz-Weiß-Filme wie jenen, der die Vokabel ‚Gaslighting‚ schuf und in dem Ingrid Bergman als Hausherrin unter einer intriganten Angela Lansbury als Zofe zu leiden hatte.
Aber was auch immer wir vor Augen haben: Das Dienstmädchen wird nur selten zur alleinigen Hauptperson, selbst wenn wie in den beiden erstgenannten Verfilmungen sie mehr ist als nur eine Haushaltsmaschine auf zwei Beinen. Dann allerdings muss sich ihr bescheiden-trist-grauer Alltag neben der großartig-bunten Lebensweise der Herrschaft beweisen und bietet im Grunde somit doch nur den Rahmen für die eigentlichen Dramen der guten Gesellschaft.

Ich merke, ich komme gerade in ein ganz anderes Fahrwasser; da wollte ich gar nicht hin.
Was ich eigentlich hatte sagen wollen: Wir stellen uns meist ein hochherrschaftliches Haus vor mit ausreichend Personal – insbesondere mit männlichem Personal in den hohen Positionen.
Vielleicht sehen wir auch eine ältere Witwe, die ihre Gesellschafterin/Zofe/Köchin/Pflegerin scheucht (die haben wir gerne mal in Agatha Christie-Verfilmungen) oder die frühere Kinderfrau, die in der Familie bleibt, weil sie sich anderweitig nützlich zu machen verstand und die Kinder doch so sehr liebt, oder die freche Zofe, die der unverheirateten Tochter des Hauses hilft, ihre ach so feministischen Ziele zu erreichen – es ist halt spannender, Ärztin werden zu wollen, da kann man locker darüber hinwegsehen, dass die Zofe bei all dem ihre Zukunft riskiert.
Aber hey, wenn alles gutgeht, dann darf sie danach bei der Freundin arbeiten, hurra!
Wie es aber auch ist: Das Dienstmädchen, welche Funktion sie auch haben mag, wie hübsch, niedlich und clever sie ist, bleibt meist der Herrschaft untergeordnet. Sie ist kaum mehr als ein Ding, über das man sich schnell ärgert, wenn es einmal nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Im Film und im Roman ebenso wie in der Wirklichkeit.
Natürlich gibt es Ausnahmen. Im Film, im Roman und in der Wirklichkeit. Aber dennoch hatte auch ich die beschriebenen Bilder im Kopf. Weshalb ich jetzt diese Geschichte schreiben will und endlich zu dem komme, wo ich hinwollte: Wo also fand eine junge Frau eine Stellung? Nur selten arbeitete sie bei Königs, Kaisers oder anderen Fürsten, selten auch gelang einem Mädchen vom Lande (woher die meisten stammten) der Aufstieg zur Zofe bei einer Adelsfamilie.
Am häufigsten und in der Regel auch als Erstes arbeitete sie bei Handwerks- oder Kaufmannsfamilien der kleinbürgerlichen Schicht. Hier war ihre Rolle oft noch so, wie sie in den etwa zweihundert Jahren zuvor noch gewesen war: Sie galt als Teil der Familie, die – wie alle anderen auch – mit anpackte, am selben Tisch saß und aß.
Die Hausfrau wurde nämlich im Geschäft benötigt, weshalb die Familie jemanden brauchte, der sich ums Essen, die Wäsche und die Kinder kümmerte. Viel war dort nicht zu verdienen, aber wenn man das Glück hatte, bei netten Menschen gelandet zu sein, dann lebte man dort freier und anerkannter als beispielsweise in einem gutbürgerlichen Haushalt.
Dort nämlich konnte man selten mehr als zwei Mädchen beschäftigen und oft fehlte sogar das Geld, auch nur eines anständig zu bezahlen. Hier aber ging es ohne Hausangestellte nicht – man war auf dem Weg nach oben und das bedeutete, die Gattin hatte zu repräsentieren, musste vorführen, dass der Ehemann erfolgreich war, dass man mit ihm rechnen musste.
Da sie diejenige war, die mit einem meist sehr knappen Budget den Haushalt zu führen hatte, war sie eher wenig entspannt, wenn das Dienstmädchen einen Teller zerbrach oder nicht fleißig genug war – jede Extraausgabe musste sie vor dem Ehemann rechtfertigen. Wenn er nun auch noch ein Auge auf die jüngere Angestellte warf, dann wurde diese Hausgemeinschaft schnell unerträglich – alle standen unter Druck und beäugten sich misstrauisch, doch am längeren Hebel saß die Herrschaft. Das schlechte Arbeitsklima machten die etwas höheren Einkünfte oft nicht wett.
Gelang es dann doch, in ein hochherrschaftliches Haus zu kommen, so fand man sich meist ganz unten wieder, denn nicht nur die Herrschaft stand über der Angestellten, sondern auch unter den Dienstboten gab es diejenigen, die etwas zu sagen hatten, und diejenigen, die schwiegen.
Hatte das Dienstmädchen davon geträumt, in einer riesigen Villa ein eigenes Zimmer zu erhalten oder besseres Essen, so bewahrheitete sich das nicht immer. Je reicher, desto knickriger, das gaben viele frühere Hausangestellten zur Antwort, wurden sie befragt. Die Erwartungen der Herrschaft stiegen, die Angebote an Freiheit oder auch nur die Sorge für ein gesünderes Arbeiten blieben dahinter weit zurück.
Da wundert es nicht, dass es nur wenige Dienstmädchen gab, die die in manchen Städten ausgeschriebenen Belohnungen für zehn Jahre treue Dienste einstreichen konnten. Wer nett aussah und gelernt hatte sich auszudrücken, bemühte sich um eine Stellung als Verkäuferin in einem der vielen modernen Warenhäuser. Wer gut mit Nadel und Faden umging, hatte Chance auf eine Arbeit als Näherin in einem Schneideratelier. Wenn einer solche Talente fehlten und sie nichts mehr mit Hausarbeit im Sinn hatte, der blieb noch die Arbeit in der Fabrik, während besonders Unglückliche in die Prostitution abrutschten, was aber weniger häufig geschah, als es uns Filme, Romane und Kolportagen glauben machen wollten.
Für die meisten allerdings war der Weg raus aus dieser Schinderei die Ehe, wobei Liebe nur selten eine Rolle spielte. Die aus dem Dienst fliehende Frau wollte finanziell abgesichert sein; der Ehemann profitierte hingegen von einer Partnerin, die hart zu arbeiten verstand und auch das Gehorchen gelernt hatte.
All diese Erkenntnisse habe ich mir natürlich nicht alleine durch das Lesen alter Zeitschriften, Pamphlete und Ratgebern verschafft; sie unterstrichen allerdings den Wert zweier Arbeiten aus den 1980er zu diesem Thema. Dorothee Wierling und Karin Walser haben damals – getrennt voneinander – Fakten gesammelt und ehemalige Mädchen befragt. Ihnen verdanke ich das Fundament, auf das ich meine erfundene Geschichte stellen möchte.